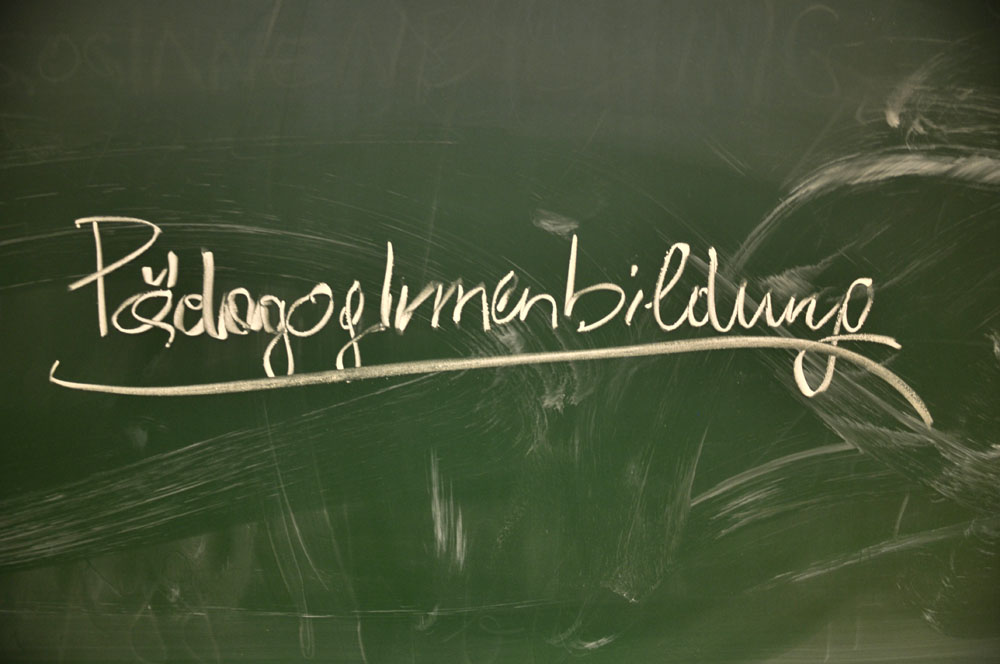In ungewohnter Eintracht kritisieren Universitätenkonferenz (uniko) und Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) die geplante Reform der Lehrerausbildung. Sowohl die Rektoren als auch die Studentenvertreter befürchteten bei einer gemeinsamen Pressekonferenz durch die Gesetzesentwürfe, deren Begutachtungsfrist heute (3. Mai) endet, einen Qualitätsverlust. Grund dafür ist, dass die Absolvierung eines Masterstudiums keine unabdingbare Voraussetzung für die Ausübung des Lehrerberufs ist.
Dieser Plan sei zwar als Absicht formuliert, meinte die Vizerektorin der Uni Wien und stellvertretende Vorsitzende des uniko-Forums Lehre, Christa Schnabl. Es fehle aber eine entsprechende Verankerung im Dienstrecht. So bestehe die Gefahr, dass aufgrund des sich abzeichnenden Lehrermangels Abstriche gemacht werden und auch Bachelor-Absolventen an AHS unterrichten. Überhaupt sei in den Entwürfen „die Tendenz spürbar, dass sehr viele Absichten formuliert werden, die rechtlichen Verbindlichkeiten aber noch sehr mangelhaft sind". Auch die ÖH fordert die Verankerung eines verpflichtenden Masterabschlusses als Erfordernis für eine langfristige Anstellung im Lehrer-Dienstrecht.
Institutionenfrage unbeantwortet
Gemeinsamer Kritikpunkt von ÖH und uniko ist auch die fehlende Beantwortung der Institutionenfrage: Die Entwürfe ließen offen, ob künftig nach Schulstufen oder Schultypen ausgebildet werde - also ob es künftig wie bisher Lehrer für AHS bzw. BMHS einerseits und Pflichtschulen andererseits geben werde oder ob Lehrer etwa für Sechs- bis Zehnjährige, Zehn- bis 14-Jährige etc. ausgebildet werden.
Weiters kritisiert die uniko den Aufbau von Doppelstrukturen etwa durch die Einrichtung eines Qualitätssicherungsrats und den faktischen Zwang zu Kooperationen mit den PH sowie die nicht vorgesehene Abdeckung der Mehrkosten für die Neuorganisation des Lehrerausbildung. So sei es etwa sinnlos, den an den Unis vorherrschenden forschungsgeleiteten Zugang an den PH noch einmal aufzubauen, so Schnabl. Man müsse schon auch realistisch sein und sehen, dass das Forschungsniveau der Unis schon aufgrund der kleineren Anzahl der Forscher an PH nicht erreicht werden könne, betonte der Vorsitzende des uniko-Forums Lehre, Martin Polaschek. Er habe den Eindruck, „dass man versucht, die PH im Forschungsbereich hochzurüsten", was zum Teil allerdings eine Verschwendung von Ressourcen darstelle. Umgekehrt komme man ja auch im schulpraktischen Bereich nicht auf die Idee, die Unis hochzurüsten.
Langfristig wollen die Unis die gesamte Ausbildung für die Sekundarstufe ausschließlich an den Unis implementieren. An den PH könnten neben dem Volksschulbereich auch die Ausbildung der Kindergartenpädagogen angesiedelt werden, die derzeit nicht von der neuen Lehrerausbildung erfasst sind, so Schnabl. Eine andere Variante wäre das Aufgehen der PH in den Unis, so die Vizerektorin auf eine entsprechende Frage. Das sei aber eine politische Frage.
Unis sehen sich benachteiligt
Ganz generell sehen sich die Unis benachteiligt: Die Gesetzesentwürfe würden eine „Stärkung der Pädagogischen Hochschulen und eine Einschränkung der Universitäten bedeuten", heißt es in ihrer Stellungnahme. Kritik übte Polaschek auch daran, dass für die Einrichtung eines Qualitätssicherungsrats, dem Stellungnahme-, Kontroll- und Freigaberechte bei der Studienplangestaltung zukommen, 500.000 Euro vorgesehen seien, den Unis aber für die Implementierung der neuen Ausbildung kein Cent mehr zugestanden werde.
Die ÖH wiederum forderte ein Aus für die Zwei-Klassen-Gesellschaft bei den Pädagogen. „Ziel muss eine gemeinsame Ausbildung in einer gemeinsamen Struktur sein", so die stellvertretende ÖH-Vorsitzende Janine Wulz (Grüne und Alternative StudentInnen, GRAS). Die Conclusio des Gesetzes sei dagegen, dass die Ausbildung mit PH und Unis weiter an zwei Institutionen stattfinden solle. Studienrechtlich stößt sich die ÖH an der Studieneingangs- und -orientierungsphase (STEOP): Diese solle an den Unis 2015 auslaufen, an den PH aber jetzt eingeführt werden – „und zwar in unverantwortlicher Härte". Auch die Gestaltung der Aufnahmeverfahren sei uneinheitlich: An den PH werde die pädagogische Eignung abgetestet, an den Unis gebe es einen wissenschaftlichen Test. Die ÖH lehnt Aufnahmeverfahren grundsätzlich ab - wenn sie aber schon kämen, dürfe lediglich auf die pädagogische Eignung abgestellt werden.